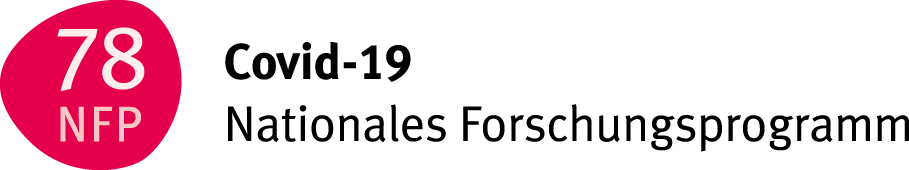Kognitive Beeinträchtigungen durch COVID-19

Bereits im April 2020 wurde auf der Grundlage klinischer Beobachtungen in der akuten Phase der Infektion angenommen, dass neuropsychologische Störungen über die akute Phase von Covid-19 hinaus bestehen bleiben.
Hintergrund
COVID-19 geht in der akuten Phase der Infektion häufig mit neurologischen und kognitiven Beeinträchtigungen einher. Als mögliche Ursachen wurden Neuroimmun- oder Gefässerkrankungen identifiziert. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass neuropsychologische Folgen zurückbleiben, selbst bei milden und moderaten Verläufen von COVID-19. Wichtig ist auch, die neuropsychiatrischen Probleme zu berücksichtigen, die durch Präventionsmassnahmen wie Lockdown, durch Ansteckungsangst oder posttraumatische Belastungsstörungen entstehen, da diese die kognitive Leistung und Reserve ebenfalls erheblich beeinflussen.
Ziel
Ziel des COVID-COG-Projekts war es, die möglichen kurz- und langfristigen neuropsychologischen Folgen von Covid-19 6 Monate und 12 Monate nach der Infektion zu bewerten.
Resultate
Das Fortbestehen der kognitiven Störungen 6-9 Monate und 12-15 Monate nach der Infektion wurde bestätigt. Die Störungen standen nicht im Zusammenhang mit dem Schweregrad der Atemwegserkrankung in der akuten Phase. Es wurden drei verschiedene klinische Phänotypen identifiziert, wobei die am stärksten diskriminierende Variable die Selbstwahrnehmung der kognitiven Störungen ist. Einige Patientinnen und Patienten zeigten ein mangelndes Bewusstsein für ihre Störungen, aber mit objektiven Gedächtnisstörungen. Die Patientinnen und Patienten am anderen Ende des Spektrums berichteten über zahlreiche Beschwerden, insbesondere über Müdigkeit, zeigten aber nur leichte Aufmerksamkeits- und affektive Störungen. Eine dritte Gruppe von Patientinnen und Patienten hatte normale Leistungen und kongruente Beschwerden.
Diese Störungen wurden mit Veränderungen der funktionellen Konnektivität des Gehirns in Verbindung gebracht. Zur Erklärung des Fortbestehens dieser neurokognitiven Symptome wurden mehrere Hypothesen aufgestellt, wobei viele Fragen unbeantwortet blieben.
Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Pandemie
Diese Ergebnisse wurden von Kohortenstudien weltweit bestätigt. Im Jahr 2021 veröffentlichte das COVID-COG-Team als erstes eine Arbeit, in der die Heterogenität der Profile neuropsychologischer Störungen beschrieben wurde, wodurch die Schweiz eine weltweit führende Rolle auf dem Gebiet des neuropsychologischen Post-COVID-Syndroms einnahm. Dies ermöglichte es, Klinikerinnen und Kliniker mit klinischen Empfehlungen und Leitlinien zu versorgen und Patientinnen und Patienten zu informieren.
Originaltitel
Kurz- und langfristige neuropsychologische Beeinträchtigungen nach COVID-19 (COVID-COG)